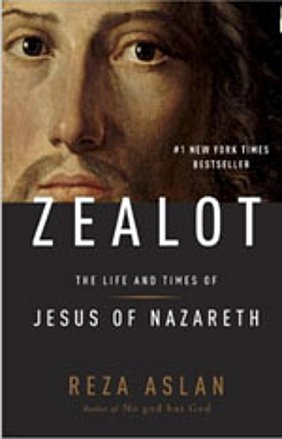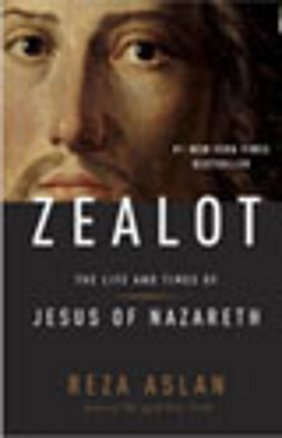Darf ein Muslim über Jesus schreiben? Seit die Moderatorin Lauren Green bei Fox News ihre verständnislose Frage stellte und der Autor Reza Aslan lapidar antwortete: »Warum nicht?« – seither schlagen die Wellen hoch in den USA.
Lauren Greens Albtraum ist der des konservativen Amerikas: Durch islamistische Gotteskrieger wurden unsere christlichen Grundfesten erschüttert. Und nun bemächtigt sich ein Muslim auch noch der Gründergestalt des Christentums. Jesus wird vom Erlöser und Friedefürsten zum »Zeloten« verzerrt, zum Eiferer für die Sache des Herrn, ja zum Gotteskrieger. Aslans Buch heißt Zealot – Life and Times of Jesus Christ. Aber kann man Jesus wirklich als Zeloten bezeichnen? Aslan behauptet nicht, dass Jesus ein früher Anhänger der Zelotenpartei war, einer radikalen Gruppierung, die erst nach dem Aufstand des Jahres 66 Wirkmacht entfaltete, sondern spielt an auf das Wort Eiferer. Der Religionssoziologe zeichnet das Bild eines Revolutionärs aus dem armen Galiläa, dessen Ziel nicht so sehr ein himmlisches Königreich war als ein Palästina ohne römische Besatzungsmacht.
Aslans Jesus ist ganz und gar Jude, beseelt vom messianischen Gedanken, dass König Davids Israel wiedererstehen müsse als Staat unter Gottes Autorität. Für manche Zeitgenossen war diese Erwartung realistisch, für andere Utopie. So gab es eine Reihe von Predigern, die wie Jesus Anhänger zu gewinnen suchten für Israels Unabhängigkeit. Aslan zeichnet Jesus als einen Mann, der bereit war, Gewalt auszuüben, und der Judäas priesterliche Oberschicht kritisierte, weil sie mit den Römern kollaborierte.
Die Vorstellung vom eifernden Jesus hat viel mit innerjüdischen Erwartungen jener Zeit zu tun, aber nichts mit den Lehren des Islams über den Propheten Jesus. Trotzdem trifft Reza Aslan mit seiner eigenen Religionszugehörigkeit einen wunden Punkt, das zeigen die vielen islamophoben Reaktionen. So behauptete der Pastor John S. Dickerson aus Arizona, ein Wortführer der Evangelikalen, Aslan verbreite entstellende Lehren über Jesus, wie der Islam als Gegner des Christentums es schon seit Hunderten von Jahren tue, um die Kirche zu zerstören.
Nein, Aslans Interesse an Jesus ist nicht bloß akademischer Natur. Als Flüchtlingskind vor der iranischen Revolution in Kalifornien groß geworden, nimmt ihn dort als 15-Jähriger das evangelikale Christentum ein. Später überzeugt ihn die Christologie der Kirche nicht mehr. Die wissenschaftliche Betrachtung des Neuen Testaments durch seine jesuitischen Lehrer an der Santa Clara University weckt sein Interesse. Kurz vorm Magisterstudium an der Harvard Divinity School kehrt Aslan zum Islam zurück. Ein bekehrter Muslim, der Christus ablehnt? Zur vermeintlichen Herabwürdigung Jesu kommt in den Augen frommer Christen noch die Apostasie.
Der Autor, verheiratet mit einer Christin und Schwager eines evangelikalen Pastors, freut sich über die Debatte. War es sein Ziel zu provozieren? Der Titel Zealot spräche dafür, der Inhalt dagegen. Die Fakten sind solide, aber keineswegs neu. Das Buch gehört zum Genre der Leben-Jesu-Forschung, die auf Hermann Samuel Reimarus im 18. Jahrhundert zurückgeht. Sie erlebte bis in die neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts drei große Wellen. Wahrscheinlich ist Aslan aber der erste muslimische Autor.
»Ein Bibelwissenschaftler wird nicht viel Neues in meinem Buch finden. Ich mache die Debatte der Forscher für eine breite Öffentlichkeit zugänglich.« Tatsächlich gelingt es Aslan, die historisch-kritische Methode dem Leser nahezubringen. Dabei bezieht er sich ausdrücklich auf den Marburger evangelischen Neutestamentler Rudolf Bultmann und dessen »Entmythologisierung als existentiale Interpretation« und zeichnet ein ziemlich akkurates Bild davon, was wir über den historischen Jesus wissen.
Es ist schon komisch: Für Joseph Ratzinger war der Jesus der Forschung zu dürres Material, also schrieb er sein dreibändiges Werk über den Christus des Glaubens. Nun kommt Reza Aslan und bietet seinen Lesern gerade diesen historischen Jesus – und zwar in Cinemascope. Die Anmutung beim Lesen, in Monty Pythons Leben des Brian gelandet zu sein, kommt nicht von ungefähr. Aslan selbst sagt, die Pythons hätten mit ihrem Film das damalige Milieu gut getroffen. So entfaltet der Professor für kreatives Schreiben der University of California (Riverside) eine höchst lesbare Biografie, führt uns in die Welt Jesu und des Judentums ein. Er beschreibt in großem Detail und mit aller Farbigkeit die Situation und zeigt, dass Religionsgeschichte unterhaltend sein kann.
Man liest auch als Wissenschaftler das Buch mit Gewinn. Denn Aslan spricht aus, was vielen Theologen unaussprechlich ist. Wenn es sein Ziel war, vielen Menschen klarzumachen, warum Jesu Mission noch heute bedeutsam sein könnte, dann ist ihm das gelungen. Er schält einen Messias heraus, der den Rabbinern nahesteht, das Judentum über die römische Herrschaft stellt und den Supremat des jüdischen Gottes herstellen will. Dieser Jesus wirkt im Kontext seiner apokalyptisch gestimmten Zeit. Er ist ein Aufwiegler mit religiösen Zielen und politischem Charisma, eine Provokation für die sadduzäische Elite und die jüdische Oberschicht ebenso wie für die römische Besatzungsmacht. Aslan erklärt, warum die Evangelien später ein anderes Bild zeichnen, als das Christentum römische Staatsreligion wird.
Auch andere, nicht zuletzt jüdische Forscher haben vermutet, dass Jesus ein Revolutionär war. Dass die Herrschaft Gottes ohne Anwendung von Gewalt gegen die römische Okkupation kaum hätte durchgesetzt werden können. Zu den bedeutenden neueren Werken gehören König Jesus – die Geschichte eines jüdischen Rebellen des britischen Judaisten Hyam Maccoby (1985), Jesus der Jude des Oxforder Qumranforchers Geza Vermes (1991) und Jesus – ein revolutionäres Leben des irisch-amerikanischen Neutestamentlers John Dominic Crossan (1996). Für all diese Versuche einer Novellierung des Jesusbildes gilt, was Albert Schweitzer schon 1906 formulierte: Auf den Erlöser werde immer ein Ideal vom Menschen projiziert. Bei Aslan ist ein sauber recherchiertes Buch herausgekommen. Nicht simplifizierend, aber einnehmend für eine komplexe Materie.
Erstaunlich ist dennoch, dass Aslan keine spezifisch muslimische Frage aufwirft. Er rüttelt zwar an den Grundfesten des Christentums, kommt aber zu ähnlichen Einschätzungen wie viele jüdische Kommentatoren seit dem 19. Jahrhundert, allen voran Abraham Geiger (1810 bis 1874). Insofern ist das Buch ganz unspektakulär. Sein rasanter Erfolg ist nicht auf die Thesen des Autors zurückzuführen, sondern auf die Empörung darüber, dass ein Muslim es wagt, sich über Jesus zu äußern. Genau diese Reaktion hatten deutsche Rabbiner wie Geiger zu spüren bekommen, die im 19. Jahrhundert das Gleiche über den Juden Jesus aussagten, was Aslan heute wiederholt. Die Debatte über Zealot ist ein Gradmesser für das abgrundtiefe Misstrauen, mit dem Muslime heute in den US A konfrontiert sind.
Reza Aslan:
Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth
New York 2013, Random House
336 Seiten
ISBN: 978-1400069224