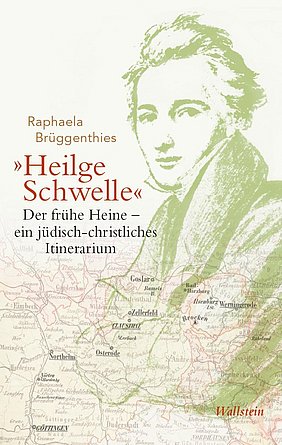Die Leser:innen werden zügig und in hoher Informationsdichte mit einem durchgängig gut, ja fesselnd zu lesenden Text in die vielfältige geistige Szene des postnapoleonischen Deutschlands geführt. Dass auch schon der junge Heine der Jahre 1816 bis zum Jahr seiner Konversion 1825 hier mindestens maßgeblicher Rezipient und mit dem Erscheinen seiner ersten Werke, spätestens seiner Harzreise auch als Autor einflussreicher Akteur war, ist eine der wesentlichen Erkenntnisse des Bandes. Die Verfasserin führt sicher durch die bewegte Biographie und stellt überraschende Querverbindungen her, wenn sie nicht nur die Korrespondenz Heine umgebender Persönlichkeiten wie den Mitgliedern des Berliner Vereins für Cultur und Wissenschaft der Juden und Rachel Varnhagens in die Schilderung von Heines Entwicklungsprozesses einbezieht, sondern auch die Tagespresse, die zeitgenössische Literatur zum aufkommenden Harz-Tourismus, Buch und Theater-Rezensionen, Goethes Schriften, die zunehmend zu Heines Leuchtstern werden, römische Inquisitionsakten und vieles mehr in die Darstellung dort einbezieht, wo sie für den jungen Heine relevant werden.
Die Arbeit ist vom Aufbau her streng werkgeschichtlich angelegt. Die Verfasserin begleitet in drei jeweils 100–150-seitigen Großkapiteln die drei frühen Werke Heines, um die es ihr geht: (1.) Tragödie einer utopischen Projektion: Almansur (15–96); (2.) Kryptogramm einer verfehlten Konversion: Der Rabbi von Bacherach (97–150); (3.) Itinerar einer befreienden Evasion: Die Harzreise (251–406).
Die eng dem Text folgende und bzgl. Hintergründen die Zeitebenen frei wechselnde Darstellungsweise machen eine sorgfältig gearbeitete chronologische Übersicht am Ende notwendig, und hier liegt vielleicht ein möglicher Kritikpunkt an der Methodik der Arbeit: Nicht selten kommt der/dem Leser:in beim tiefen Eintauchen in Heines Psyche der Zeitstrahl abhanden. Diese Übersicht trägt den beziehungsreichen Titel „Itinerar der Schwellenzeit“ (412–416) und enthält neben den zeitlichen Daten biographische und publizistische Fakten sowie – und hier findet sich so etwas wie die Essenz von B. Arbeit – „Themen des inneren Itinerars“. Hier werden also die mentalen, emotionalen und intellektuellen Koordinaten benannt, zwischen denen sich Heine in der Zeit seiner Konversion bewegt. Für die Jahre 1821–1823 finden sich hier etwa die Einträge Ausgrenzung, Deutschtum und Berliner Salons, jüdisches Zugehörigkeitsgefühl, Konfrontation mit polnischem Judentum, Hoffnung auf neu-jüdische Literatur, antisemitische Ressentiments, Rassismus und Antisemitismus. Die Verfasserin setzt den Begriff „Itinerar“ als bekannt voraus. Gemeint ist die mit faktischen Reisebewegungen eng verflochtene Biografie eines äußerst beweglichen Poeten und Intellektuellen, der die eigene Existenz als „Auf-dem-Weg-befindlich“ bzw. „Auf der Schwelle“ definiert. Zwischen den beiden Religionen und verschiedenen Gesellschaftsschichten, zwischen Stadt und Land, zwischen Realität und Poesie.
Informationen über Biografie und Werk erhellen einander gegenseitig. So erfährt der/die Lesende nicht nur viel über die Szene jüdischer Intellektueller, ihre Herkunft, Selbstorganisation und erträumte Zukunft, weit über die Biografie Heines hinaus, sondern wird auch in einmaliger Weise gewahr, wie diese Kumulation auf höchst intelligente, humorvolle, unterhaltsame und teilweise bis heute epochal hellsichtige Weise in den drei bearbeiteten Werken Niederschlag findet. Exemplarisch soll nun noch ein kurzer Blick auf die Erkenntnisse geworfen werden, die B. aus jedem Werk auf spezifische Weise zieht. Denn dieses Buch muss man ganz lesen. Diese Rezension will dazu anregen.
Heines Erstlings-Drama Almansor, das nach vermutlich antisemitischen Tumulten bei der Erstaufführung in Braunschweig 1823 nie wieder inszeniert wurde, spielt um 1500 in der Gegend von Granada. Almansor thematisiert die Situation der in Spanien verbliebenen „Mauren“ mit ausdrücklichem Bezug auf die Lage der Jüdinnen und Juden im Europa seiner Gegenwart. U. a. fällt hier der später prophetisch gedeutete Satz des Protagonisten Hassan „Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ als Reaktion auf die Verbrennung von 5000 Büchern islamischer Theol. (darunter des Koran), der Phil., Geschichtsschreibung und Naturwissenschaften 1499 durch den Erzbischof von Toledo und späteren Großinquisitor Francisco Jiménez de Cisneros. Heine dreht hier die romantische Mode einer Idealisierung des „heiligen Krieges gegen die Mauren“, der Reconquista also, die genauso stilprägend an der Schwelle der Neuzeit steht wie die „Entdeckung Amerikas“ und die Reformation um, und zeichnet die Muslime durchweg positiv, ja „karikiert […] die christlichen Charaktere und versieht alles Christliche mit negativen Vorzeichen“ (38). B. rekonstruiert hier nicht nur Heines detaillierte Quellenrecherche, sondern macht auch deutlich, dass seine persönliche schmerzliche Erfahrung mit offenem Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus nicht nur in einer der damals noch jungen Burschenschaften, sondern auch in den nicht-jüdischen Berliner Salons für dieses Werk relevante biographische Erfahrungen sind. Doch Heine ist nicht ihr Opfer, sondern will die dt. Literatur genau aus dieser Verengung herausführen. So darf man ein zentrales Movens seines gesamten Werkes begreifen, das hier erstmals greifbar wird. Dabei darf er sich bereits in den Fußspuren von Goethes West-östlicher Divan wissen.
Mit seiner Fragment gebliebenen Erzählung Der Rabbi von Bacherach steht Heine plötzlich mitten in der orth. jüdischen Tradition. Entscheidend für die Hinwendung zur nicht-intellektuellen und zugleich urtümlich jüdischen Figur eines wegen Ritualmordvorwurf mit dem Tode bedrohten Rabbiners, der von Bacherach nach Frankfurt flieht und im dortigen Ghetto vom Regen in die Traufe kommt, war aber wohl eine Polenreise 1822, die Heine zunächst in seinem kosmopolitischen (und damit erneut provokativen) Text Über Polen verarbeitet. Hier begegnet er aber v. a. den „Shtetl-Juden“, die vom westeuropäischen Judentum bis ins 20. Jh. hinein als schmutzig, unzivilisiert, arm und also nicht assimilationsfähig verachtet und schnell zum Negativ-Ideal des rassistischen Antisemitismus stilisiert wurden. Heine macht sich nun erneut Feinde auch unter Seinesgleichen, wenn er narrativ im Rabbi von Bacherach, aber auch theoretisch in einer späteren Würdigung Ludwig Börnes ein klares Plädoyer, wenn nicht eine Liebeserklärung eben für dieses rabbinische Judentum verfasst (H. Heine, Ludwig Börne. Eine Denkschrift, DHA 11, 38–39, zit. Brüggenthies, 106).
Die 1826 wie auch schon Almansor zunächst in scharf zensurierter Form in der Zeitschrift Der Gesellschafter und später unzensiert bei Hoffmann und Campe erschienene Harzreise machte Heine nicht nur einer breiten Öffentlichkeit bekannt und führte zu seiner Anerkennung als namhafter Autor, sondern enthält auch unterschwellige komplexe religionsphil. und -politische Bezüge, die B. bis hin zur erstmaligen Beschäftigung der römischen Inquisition mit Heine hin erschließt. Heine steht kurz vor Promotion und Konversion, fünf Jahre später verlässt er Deutschland für immer. So durchkreuzen sich religiöse, volkstümliche und biographische Motive in nicht immer übersichtlicher Weise. So wird der Brocken zum Sinai und die Harzreise zum Exodus (324). Heine träumt in der Harzreise nicht nur von Saul Ascher, dem frühen Wegbereiter einer jüdisch-deutschen Melange, dessen Buch Germanomanie 1817 auf der Wartburg verbrannt worden war (354ff), sondern auch von einem Reich der Liebe, das, trinitarisch strukturiert im Sinne Joachim von Fiores, in der Gegenwart den Heiligen Geist wirken sieht: „Dieser tat die größten Wunder, und viel größ’re tut er noch“ (362), dichtet hier und analog in späteren Gedichten Heine und denkt dabei an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und damit an die Judenemanzipation. Mit der Einschätzung dieser faszinierenden jüdisch-christlich-literarischen Utopie durch die Indexkongregation soll diese Rezension schließen. Der Konsultor Giuseppe Baria Graziosi (1793–1847) schreibt: „Die Werke dieses über eine große Vorstellungskraft und eine äußerst lebhafte Phantasie verfügenden Schriftstellers [Heine] sind trotz der Anmut des Stils von so unklarer und verworrener Machart, dass es fast unmöglich ist, eine verständliche Zusammenfassung zu geben. […] [A]lle strotzen vor religionsfeindlichen und gottlosen Grundsätzen; und in allen wird das Christentum verspottet, die katholische Religion diskreditiert; in allen triumphiert der Deismus; in allen findet man Stellen, die gegen die guten Sitten verstoßen; schließlich trachten alle danach, die Regierung in Verruf zu bringen und die Völker zur Revolution aufzustacheln […]“ (367). Es folgt 1836 die Indexierung aller Bücher der Harzreise und 1845 auch der Neuen Gedichte.
Brüggenthies' Band hat das Zeug, nicht nur eine katholische Neubewertung Heines zu initiieren, sondern mit der Wertschätzung und genauen Kenntnis seines (Früh-)Werkes auch die Irrtümer der römisch-katholischen Kirche der letzten 250 Jahre sichtbar zu machen.
Raphaela Brüggenthies:
„Heilge Schwelle“.
Der frühe Heine – ein jüdisch-christliches Itinerarium.
Wallstein Verlag
Göttingen 2022
464 S. geb.; € 39,00