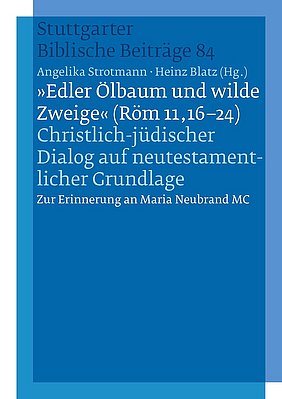Dementsprechend gliedern sich die Beiträge der 17 Verfasser:innen – weitestgehend Bibelwissenschaftler oder Kollegen der Judaistik, die sich durch positive Beiträge zum jüdisch-christlichen Dialog ausgewiesen haben, sowie Kollegen aus dem Paderborner Umfeld – in drei Abschnitte: (1.) Ntl. Grundlagen eines christl.-jüdischen Dialogs, (2.) Der christl.-jüdische Dialog in der Gegenwart und (3.) Paderborner Perspektiven – darunter auch ein Blick in die Familiengeschichte Neubrands. Aus Platzgründen können hier nur einige Beiträge kurz beschrieben werden, der Inhalt aller übrigen Titel wird angedeutet.
In mehreren Argumentationsgängen weist Angelika Strotmann nach, dass in Lev 19,18 ein universelles Liebesgebot vorliegt, das auch den Feind mit einbezieht, und dass „Quelle und Inspiration des ‚neutestamentlichen‘ Nächstenliebesgebotes in der Schrift selbst liegen“ (22). Eine Überbietung des Gesetzes durch Jesus liegt hier schon deswegen nicht vor, weil die Autoren des NTs sich als Begründung für das Liebesgebot mehrfach auf Lev 19 stützen.
Martin Ebner betrachtet die mt Antithesen in Analogie zu den im Judentum häufig sogar nebeneinander begegnenden durchaus unterschiedlichen Interpretationen der Heiligen Schrift als Aussagen über den Willen Gottes. In diesem „flexiblen Tora-Diskussions-Anwendungsrahmen, wie er für das Judentum typisch ist“ (50), bewegt sich auch der matthäische Jesus in seinen Antithesen und anderen zahlreichen Texten des Matthäus-Evangeliums, in denen Jesus konkrete Tora-Gebote auslegt. (Mt 12,9-14; 15,1-9 u. ö.)
Hubert Frankemölle geht in seinem Beitrag „Das eine Evangelium nach dem Römerbrief“ von der Situationsanalyse aus, dass sowohl auf der Gemeindeebene als auch in der christl. Theol. „immer noch zu christlich und zu wenig jüdisch im Sinne des ersten Teils der Bibel“ ausgelegt und gedacht wird (65f). Entsprechend korrigierte Exegese führt bei der Interpretation von Röm 11 zur Ablehnung der Identifikation des Ölbaums mit Israel. Dieser weist vielmehr auf eine Einheit aus christusgläubigen Juden und Heiden hin, die mit dem Volk Gottes identisch ist.
Daniel Lanzinger nimmt die nach der Enthüllung der Kuppel des Berliner Schlosses mit der bekannten an Apg 4,12 und Phil 2 angelehnten Inschrift entbrannte Diskussion auf und stellt die Frage nach den ursprünglichen literarischen und kommunikativen Zusammenhängen der beiden Textstücke und nach deren Veränderung durch die Positionierung im öffentlichen Raum. Die Antwort lautet, „dass in dieser Inschrift zwei biblische Texte zusammengebracht werden, die aus völlig unterschiedlichen Kommunikationszusammenhängen stammen, und in einen neuen Kontext gesetzt werden, der weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun hat. Damit aber werden nicht nur exegetische Standards unterlaufen, sondern v. a. auch die seit mehreren Jahrzehnten erarbeiteten Standards des interreligiösen Dialogs im Allgemeinen und des jüdisch-christl. Dialogs im Besonderen.“ (100) In der Inschrift komme „nicht der Herrschaftsanspruch ‚des‘ Christentums, sondern derjenige von Friedrich Wilhelm IV. samt seiner Privattheologie“ zum Ausdruck (102).
Heinz Blatz behandelt die Vision und den mit ihr verbundenen Hymnus in Apk 15,1–4 und spürt dabei den in dieser Collage zahlreich vorhandenen Anspielungen auf das AT und dem jüdischen sowie paganen kaiserzeitlichen Hintergrund nach. Auch die innertextlichen Rückverweise kommen zur Sprache. Dabei zeigt sich, dass die vom Verfasser verwendeten Bilder sich sowohl auf jüdischem als auch auf paganem Hintergrund verstehen lassen und deswegen bei der Interpretation nicht scharf gegeneinander abgegrenzt werden können. In Apk 15 ist insofern „ein Interagieren in und mit einem vielfältigen, pluralen Umfeld auszumachen“ (121). Der Verfasser positioniert sich in Apk 15 wie in weiteren Textstücken deutlich gegen in seinem Umfeld vorhandene Herrschaftsstrukturen.
Thomas Schumacher nimmt mit Eph 2,11–22 einen zentralen Text der ntl. Israeltheol. in den Blick, der lange Zeit im Sinne einer Substitution Israels durch die Kirche verstanden wurde. Seit den 60er Jahren ist diese Theorie zunehmend überwunden worden, was auch für die Interpretation von Eph 2 Folgen hatte. Neben diesem Blick nach außen spielt aber auch der Blick nach innen in dem Text eine Rolle, insofern er die Einheit von jüdischen und paganen Anhängern der Jesusbewegung (in welchem Sinne auch immer) hervorhebt (2,14–16.18 im Kontext) – es geht dabei aber um eine „Einheit in Verschiedenheit“ (135). Der Eph taugt deswegen weder als Beleg für eine Substitution Israels durch die Kirche noch als Zeugnis für eine „homogene Einheitskirche“, sondern er steht für eine „fortbestehende(n) Diversität zweier binnenchristlicher Gruppierungen […], die in Christus verbunden sind“ (147).
Klaus Wengst liefert zu dem schwierigen Text Eph 1,3–14 eine intensive Auslegung v. a. unter Berücksichtigung des atl.-jüdischen Hintergrunds. Während sich der Text in seinem ersten und letzten Teil an alle Messiasgläubigen wendet, zielt er in den VV. 11f auf die jüdischen Messiasgläubigen. Deren Bestimmung „ist nichts anderes als das, was für Israel schon immer gilt: durch ihr Leben – durch ihr Tun und Lassen, durch ihr Reden und Schweigen – ‚ein Lobpreis zu sein für Gottes Glorie‘ (V. 12)“ (162).
Hanspeter Heinz, liefert einen sehr beeindruckenden Beitrag, in dem er berichtet, was die persönliche Begegnung mit Juden mit ihm, seinem Glauben und seiner Theol. gemacht hat. „Mit meinem ‚jüdischen Ohr‘ habe ich teils irritiert, teils erfreut Neues gehört, was mir – und nicht nur mir – zuvor nie eine Frage war. Von Juden hörte ich dieses Neue – und doch war es bei näherem Zusehen nichts Fremdes, sondern im Gegenteil etwas Urkatholisches, authentisch Christliches“ (168f).
Auf den Kern der exegetischen Bemühungen um die Stellung des Judentums im NT zielt der Beitrag von Hans Hermann Henrix, „Die Bibel Israels – Basis spiritueller Nähe von Judentum und Christentum“, da hier die hermeneutische Prämisse Neubrands von Nostra Aetate 4 als „eine normative Weisung auch für die exegetische Wissenschaft“ (187) vorgestellt und positiv beurteilt wird. Es geht „darum, wie die Rede von ‚den Juden‘ im Neuen Testament […] sachgerecht auszulegen ist. Anders: Die Exegese hat sich um eine nicht antijüdische, um eine nicht anti-judaistische Auslegung der neutestamentlichen Texte zu bemühen“ (190 unter Verwendung eines Zitats von Neubrand, Kursivierung I. B.). Die Befürchtung, hier würden kirchliche Texte über die Bibel gestellt, sollen die folgenden Ausführungen im Zaum halten, wo Henrix u. a. feststellt: „Authentische Auslegung bleibt an den Text gebunden, in ihm hat sie ihre Richtschnur und ihre Normen. Authentische Schriftauslegung ist nur auf der Basis des Schrifttextes selbst möglich“ (191). Zu fragen bleibt aber, ob beide Prämissen miteinander vereinbar sind. Der Exeget kann bestimmte Stellen nicht einfach nach der ersten Prämisse interpretieren, ohne Gefahr zu laufen, die zweite Prämisse zu verletzen. Dass unabhängig von dieser Perspektivenfrage der christliche Theologe ein positives Verhältnis zum Judentum aufgegeben ist, ist deswegen nicht infrage zu stellen und versteht sich glücklicherweise inzwischen einigermaßen von selbst!
Christian M. Rutishauser knüpft daran an, dass die Kirche einerseits durchaus um die Sonderstellung des Judentums gewusst, diese Kenntnis aber lange Zeit verdrängt und Israel in die Völker eingeordnet hat. Es bedurfte furchtbarerweise der Schoa, um auf dieses Missverständnis aufmerksam zu werden. Allerdings verlief der Weg auch von da aus nicht problemlos. Im Anschluss an Nostra Aetate 4 ist aber inzwischen in einem vatikanischen Text anerkannt, „dass die Katholische Kirche keine spezifische institutionelle Missionsarbeit, die auf Juden gerichtet ist, kennt und unterstützt“ (so Nr. 40 des Dokuments „Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt“ [Röm 11,29] der vatikanischen „Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum“ von Dezember 2015; 216). Dagegen gab es zwar von päpstlicher Seite durchaus den Versuch zurückzurudern, aber dass die Juden in Bezug auf die Mission nicht mit den Heiden gleichgestellt werden können, hat auch Benedikt XVI. im Anschluss an die vorangegangene Diskussion bejaht. Freilich bleiben dennoch viele Fragen in Bezug auf das Gespräch zwischen Christen und Juden bestehen.
Susanne Talabardon fragt nach der Bedeutung der Wurzel-Metapher in Röm 11. Das von Paulus gezeichnete Bild des Ölbaums ist ganz stark von der angezielten Aussage geprägt, nämlich von der Aufrechterhaltung der göttlichen Verheißung an Israel und dem Gedanken des Heiligen Restes. Bei Paulus dient die Ölbaumpassage dazu, die bleibende Erwählung Israels und den Ort der nichtjüdischen Anhänger Jesu in den eschatologischen Ereignissen zu verdeutlichen. In dem gegenläufigen Bild von Teighebe und einzupflanzenden Zweigen sind nicht Letztere „die Garanten für die Heiligkeit des Baumes […], sondern die Wurzel“ (232).
Ausführungen zu den Gründen für die Distanzierung des rabbinisch-talmudischen Judentums vom Christentum, zum Universalismusproblem von Judentum und Christentum, dem Begehrensverbot des Dekaloges als Schlüssel einer Torahermeneutik und den Anschlussmöglichkeiten der neueren Jesus-Exegese für die Dogmatik beschließen den auf das Verhältnis von Judentum und Christentum bezogenen Teil des Sammelbd.s. Ausführungen zum Widerstand von Neubrands Vater im Dritten Reich und Erinnerungen an Maria Neubrand beschließen den thematisch weitgehend einheitlichen Bd. Der Sammelbd. gereicht Maria Neubrand zur Ehre, sie hätte sich darüber gefreut!
Edler Ölbaum und wilde Zweige (Röm 11,16–24).
Christlich-jüdischer Dialog auf neutestamentlicher Grundlage.
Zur Erinnerung an Maria Neubrand MC
hg. v. Angelika STROTMANN / Heinz BLATZ.
Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 2023. 324 S.
€ 65,00 ISBN: 978-3-460-00105-3