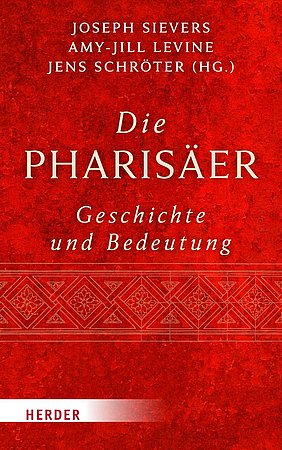Jüdische und christliche Spezialisten, darunter der Oberrabbiner von Rom, hatten sich beteiligt, und Papst Franziskus steuerte im Rahmen einer Audienz ein Grußwort bei, in dem er die Bedeutung der Pharisäer-Forschung für den Dialog hervorhob, wenn es darum geht, die gerade hier uralten negativen Stereotypen aufzuarbeiten. Leider konnten nicht alle englischen Beiträge in den deutschen Band aufgenommen werden. Dennoch liegt ein respektables Referenzwerk der neuesten Pharisäerforschung vor, das auch intensiv die NT-Problematik einbezieht und das man dem Sammelband von Joseph Sievers/Amy-Jill Levine (Hg.), The Pharisees (2021) an die Seite stellen kann.
Der Sammelband ist dreifach gegliedert:
a) Historische Rekonstruktion
b) Rezeptionsgeschichte
c) Der Blick nach vorn.
Der erste Teil bringt die für die jüdisch-christliche Pharisäerforschung wichtigsten Beiträge: Craig Morrison, Was ist ein Name? Zur Interpretation der Bezeichnung »Pharisäer« | Vasile Babota, Auf der Suche nach den pharisäischen Wurzeln | Vered Noam, Die pharisäische Halakha im Licht von 4QMMT | Steve Mason, Die Pharisäer bei Josephus | Paula Fredriksen, Paulus, der vollkommene Pharisäer | Kathy Ehrensperger, Der Pharisäer Paulus und der nomos | Adela Collins, Pharisäerpolemik in Mt 23 | Hermut Löhr, Das lukanische Doppelwerk als Quelle für die Geschichte der Pharisäer | Harold Attridge, Pharisäer im Joh-Evangelium und ein ganz bestimmter Pharisäer | Yair Furstenberg, Das Bild vom pharisäischen Gesetz. Gemeinsamkeiten zwischen den Evangelien und der rabbinischen Tradition | Jens Schröter, Jesus und die Pharisäer. Was wissen wir über ihre gegenseitigen Beziehungen? | Günter Stemberger, Pharisäer und Rabbinen.
Dazu eine kurze Charakteristik zu den Hauptlinien der Beiträge. Craig Morrison warnt vor kurzschlüssiger etymologischer Ausdeutung des Pharisäer-Begriffes, wie es oft in Handbüchern und Lexika geschieht. Vasile Babota findet die pharisäischen Wurzeln im gesellschaftspolitischen Umfeld der Zeit Jannais und der Endredaktion der heiligen Schriften, mahnt aber zur Vorsicht, denn keiner dieser Kontexte beantwortet die Frage, »wann genau, wie und warum die Pharisäer in der Zeit des Zweiten Tempels die Bühne betraten« (S. 60). Vered Noam zeigt an detaillierten Einzelfällen, wie die Auslegung der Halacha im Jachad von Qumran sich primär konservativ einer älteren pharisäisch-rabbinischen Schicht bedient, während später die pharisäische Auslegung freier und innovativer wird und eine »halakhische Revolution« einleitet (S. 86f).
Steve Mason gehört zu den weltweit wichtigsten Josephus-Experten (vgl. UTB 2130 Flavius’ Josephus und das NT, 2000). In seinem Beitrag Die Pharisäer bei Josephus fasst er seine Thesen gut lesbar in sechs Punkten zusammen: Wie die Sadduzäer und die Essener kommen die Pharisäer bei Josephus nur am Rande vor; die Gründe für die Popularität der Pharisäer liegen in ihrer differenzierten Gesetzes-Auslegung, die bei Übertretung zur Milde neigt und die potentielle Härte abfedert; Josephus pflichtet jeder damals wichtigen Strömung in speziellen Einzelpunkten bei, zum Beispiel betreffs Seele und Ewiges Leben; er selbst betrachtet sich als Priester und gehört keineswegs offiziell zu den Pharisäern. Im kritischen Gegensatz zu Josephus begegnen die Pharisäer im lukanischen Doppelwerk »als Verfechter von Toleranz und Geduld gegenüber den Christusnachfolgern und stellen auch viele frühe Christusjünger. Paulus selbst gibt sich als Pharisäer zu erkennen« (S. 119).
Für die Paulus-Forschung sind die beiden ausführlichen Aufsätze von Paula Fredriksen und Kathy Ehrensperger besonders aufschlussreich. Kathy Ehrensperger präzisiert die These, dass Paulus nach seinem Berufungserlebnis Pharisäer blieb. Dabei untersucht sie Paulus’ Verhältnis zum nomos und zu den Überlieferungen der Väter, die Problematik mündlich versus schriftlich u. a., auch wie man den eifernden Paulus verstehen kann. Besonders wichtig ist ihr die Frage nach der Auferstehungshoffnung (Paulus als apokalyptischer Pharisäer). Ihr Fazit: »Paulus wird von einem pharisäischen Kenner und Anwender des nomos zu einem pharisäischen Kenner und Anwender des nomos für nicht-jüdische Christus- Nachfolgende […] weil er seit seinem Berufungserlebnis überzeugt ist von der Aktualisierung pharisäischer Auferweckungshoffnungen im Christusereignis« (S. 167).
Die drei folgenden Beiträge widmen sich der Pharisäerfrage bei Mt, Joh, Lk und der Apostelgeschichte. Collins konzentriert sich auf die Weherufe in Mt 23, Löhr befragt nicht nur die Pharisäer im Mt-Ev., sondern vergleicht dieses Pharisäerbild mit Flavius Josephus, Paulus und Rabbi Gamaliel. Attridge konzentriert sich u. a. auf die Darstellung des Pharisäers Nikodemus im Joh-Evangelium.
Yair Furstenberg und Jens Schröter greifen in ihren Aufsätzen systematisch die Gemeinsamkeiten zwischen den Evangelien und der rabbinischen Tradition sowie das Thema Jesus und die Pharisäer auf. Im Verständnis von Reinheit war Jesus von einer eher offensiven Reinheit geprägt (die Unreinheit positiv verändert) im Gegensatz zur mehr defensiven Reinheit der Pharisäer (Schröter S. 270); außerdem schlägt das prophetische, autoritative Sendungsbewusstsein Jesu als Merkmal seiner Verkündigung vom nahenden Gottesreich zu Buche.
Günter Stemberger untersucht die nötige Unterscheidung zwischen Pharisäern und Rabbinen, die keineswegs direkte Nachfolger der Pharisäer waren (im Unterschied zu Jacob Neusner). Denn die liebevolle Gesetzes-Beobachtung beruht schon vorgängig auf altbiblischer Tradition und rabbinische Schriftauslegung stammt nicht notwendig von pharisäischen Vorläufern, sondern aus der allgemeinen exegetischen Tradition der Spätzeit des Zweiten Tempels (S. 287).
Was das im Dialog mit Jesus bedeutet, fassen Heschel und Forger (S. 293f) zusammen: »Als Repräsentanten des rabbinischen Judentums verstanden, wurden die Pharisäer zu Quellen der Argumentation, die entweder Jesus eng dem Judentum verbanden oder im Gegenteil darauf bestanden, dass er es ablehnte. Die Behauptung der Einzigartigkeit Jesu hing vom Bild der Pharisäer und von den Quellen für sie ab: Mt 23 oder die Mishna.«
Mit dem Beitrag Cohens zum Thema Die vergessenen Pharisäer beginnt der zweite Teil des Kongress- Bandes: Rezeptionsgeschichte. Er enthält des Weiteren folgende Aufsätze: Randall Zachman, Die Pharisäer in der Theologie Martin Luthers und Johannes Calvins | Angela La Delfa, Die Pharisäer in der Malerei | Christian Stückl, Eine kurze, persönliche Geschichte der Oberammergauer Passionsspiele | Adele Reinhartz, Die Pharisäer im Film | Susanne Heschel und Deborah Forger, Die Pharisäer in der neueren Forschung | Roland Deines, Aspekte der Forschungsgeschichte. Die deutschsprachige Pharisäerforschung seit 1973.
Die beiden Forschungs-Überblicke ergänzen sich hervorragend und bieten auch den Experten eine verlässliche Hilfe zur Koordination ihrer Positionen. Wenden sich die Beiträge zur Forschungsgeschichte eher an die Experten, so sind die Aufsätze zu den Pharisäern in der Theologie der Reformatoren, in der Malerei, den Passionsspielen und im Film für jede(n) mit Gewinn zu lesen; sie bieten Hilfe zum Umgang mit Klischees und Vorurteilen, wie sie sich am Pharisäerbild seit Jahrtausenden festmachen.
Der dritte Teil des Sammelbandes steht unter der Überschrift Der Blick nach vorn und beschränkt sich auf zwei, aber zwei sehr wichtige Aufsätze: Amy-Jill Levine, Über Pharisäer predigen – gegen Vorurteile | Massimo Grilli und Joseph Sievers, Welche Zukunft haben die Pharisäer?
Dabei geht es darum, wie man in der Praxis Texte interpretiert, die von Pharisäern handeln, oder wie man als Laie, Kleriker oder Religionslehrer:in damit umgeht. Amy-Jill drückt das ohne Scheu aus: »Dann muss die Frage, wie sie die Pharisäer darstellen und wie diese Schilderungen für die Gemeinde zu interpretieren sind, in aller Sorgfalt, unter Gebet und kritisch behandelt werden«. (S. 451) Und Grilli/Sievers stellen sieben hermeneutische Grundsätze zusammen, die gleichzeitig Appelle an alle sind, die sich mit einem »schwierigen« Pharisäer-Text oder überhaupt mit polemischen Texten anderen gegenüber befassen (S. 464f)
Der Sammelband ist äußerst sorgfältig redigiert und bietet zu den besprochenen Themen eine Fülle einschlägiger Literatur plus ein ausführliches Register. Die Übersetzung aus dem Englischen von Claus-Jürgen Thornton ist sehr gut gelungen.
Sievers, Joseph | Levine, Amy-Jill | Schröter, Jens (Hg.):
Die Pharisäer. Geschichte und Bedeutung.
Herder Verlag
Freiburg/Br. 2024
488 Seiten
Euro 42,-