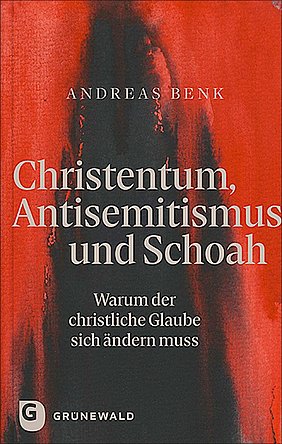In diese Situation „fällt“ die anzuzeigende Publikation Andreas Benks wie ein Stein in eher ruhiges Wasser. Der offene, direkte und ungeschützte Ton wie die Reichweite der vertretenen These wollen (?) und können provozieren.
All das, was wir zur Zeit geschehen lassen: Wohlstandserhaltung auf Kosten anderer, weltweiter Waffenhandel u.ä. korreliert Benk mit der weitreichenden Indifferenz und Apathie von Kirche und Christ*innen gegenüber der Schoah während der NS-Zeit. Den Grund für solche Teilnahmslosigkeit macht er im Übergang von „der jesuanischen Inklusion zur christlichen Exklusion“ (S. 13) aus. Letztere aber bedeutet nichts Geringeres als eine „Selbstbestätigung und Selbstbehauptung auf Kosten anderer“ (S. 14). Der Ursprung aller späteren Ausschlüsse, die die Geschichte des Christentums durchziehen, macht Benk in der Exklusion der Judenchristen aus den frühen Gemeinden aus und im Gefolge im Ausschluss des Jüdischen überhaupt aus dem Christlichen. Trotz der Akzeptanz des Tanach, christlich als Altes Testament „umformatiert“, artikuliert sich christliche Identität geradezu als Widerspruch gegen das Judentum. Mit Wengst sieht der Autor darin den „Geburtsfehler“ des Christentums. (1. Kapitel)
Deshalb bleibt es nicht beim „erste[n] Entsetzen“ über das Grauen von Auschwitz. Ihm folgt ein zweites: „Christliche Theologie und Kirchen haben zur Schoah beigetragen“ (S. 15) und ein wirklich offenes vorbehaltloses Bekenntnis zu dieser Mitschuld der Kirche – und eben nicht nur zu der Einzelner in der Kirche – steht bis heute aus. Die Erkenntnis und Anerkenntnis dieser Schuld aber steckt das Maß auf für die notwendige Revision von Theologie. Mit Irving Greenberg geht Benk davon aus, „that what died in Auschwitz, was not the Jewish people but Christianity“ (S. 88), mit Elie Wiesel von einem „end of orthodox Christianity“. (S. 81)
Der notwendigen tiefgreifenden Revision respektive einem Neuentwurf von Theologie will das Buch zuarbeiten. Solches kann nicht unterhalb persönlichen Engagiertseins geschehen. Durchgängig spricht Benk von „meiner Kirche“, auch und nicht zuletzt bei ihrer Kritik, wenn er sich der Facetten und Dimensionen der Schuld (2. Kapitel) vergewissert: des Judenhasses und Antisemitismus, der Teilnahmslosigkeit und Passivität, des Schweigens des Papstes, ja, selbst der aktiven Mittäterschaft der Christ*innen; schließlich befanden sich unter den bis zu 250.000 am Holocaust Beteiligten prozentual viele von ihnen.
Von diesem Hintergrund her drängt sich die Frage auf:
„Was bleibt von diesem Christentum, das bis in seinen Wesenskern von Judenfeindlichkeit infiltriert ist, wenn auf jegliche Judenfeindlichkeit radikal verzichtet wird? Wie ist christliches Selbstverständnis möglich, das keinerlei antijüdische Affekte impliziert oder auch nur begünstigt?“ (S. 81)
Um sich einem solchen Christentum zu nähern, schlägt Benk einen Weg vor: Vom Gedenken an die Opfer aus, das bleiben muss, hat die Anerkenntnis der Schuld zu folgen, die Übernahme von Verantwortung als Nachgeborene, um sich an die Arbeit einer radikalen Neubestimmung des christlich-kirchlichen Selbstverständnisses zu begeben.
Eine Zitatencollage zu Schoah und christliche[r] Schuld, optisch hervorgehoben, da auf dunklem Grund gedruckt, ist zwischen Kapitel 3 und 4 geschaltet. In Letzterem sondiert der Autor den Umgang mit der Schuld von „Vertuschung, Verharmlosung und Verstocktheit“ (S. 91) über Nostra aetate 4 bis zu zeitnahen kirchlichen Dokumenten zur Problematik. Ohne Veränderungen in Lehre und Praxis zu übersehen, fällt seine Bilanz insgesamt doch kritisch aus:
„Die Worte variieren, die Strategie bleibt dieselbe. In Superlativen wird Entsetzen und Bestürzung über das Geschehen bekundet, aber keine kirchliche Schuld eingestanden“. (S. 118)
Grund dafür sei „der exklusive Anspruch“ der Kirche, was zumal nach erfolgten Veränderungen zu Widersprüchen führe: Das Judentum als bleibendes „Volk Gottes“ zu würdigen und zugleich an der „exklusiven Heilsmittlerschaft Jesu Christi“ festzuhalten, „passt aber nicht zusammen“ (S. 121).
In Kapitel 5, dem mit Abstand umfangreichsten, belegt Benk die Wirkung eines solchen Exklusivitätsanspruchs in der Breite: Er nennt den Ausschluss der Tiere aufgrund eines christlichen Anthropozentrismus und den von ganzen Menschengruppen, sofern sie versklavt wurden und solche Sklaverei gerechtfertigt wurde. Exklusivität wirkte destruktiv in „Mission, Kolonisation und Rassismus“ (S. 149) und begegnet in der Hierarchie der „Kirche als interne Exklusion“ (S. 160), der „Ausgrenzung von Frauen“ (S. 169) wie der Gendervergessenheit in der „Normalitätstheologie“ (S. 175).
Unter den drei „Prinzipien einer Neubestimmung“ (Kapitel 6) rangiert deshalb ein Verzicht auf Exklusivität ganz oben, schließlich wandte sich Jesus „gerade auch denjenigen Menschen zu, die von vielen gemieden wurden, die ausgegrenzt, verachtet und benachteiligt wurden“. Nur Reichtum war ein Hindernisgrund für die Nachfolge. (S. 192) Den Grund für und das Instrument zur Durchsetzung von Exklusion fand die Kirche in einem Wahrheitsanspruch, wonach die tiefsten Glaubensgeheimnisse (Gott, Inkarnation, Trinität) nach Anselm von Canterbury „denknotwendig“ seien (S. 193); diesen Bogen einer zwingenden Erkenntnisnotwendigkeit, über die sich der Absolutheitsanspruch artikuliert, spannt Benk bis zu Pius´ X. Antimodernisteneid im frühen 20. Jahrhundert.
Ohne Verbindlichkeit aufzugeben, sei dagegen eine Form christlicher Identität nach einem „Exklusivitätsverzicht“ (S. 191) anzustreben. Die kenne zwar einen „Unterschied“, jedoch keinen exklusiven „Gegensatz“ zu anderen religiösen oder weltanschaulichen Identitäten: Nur auf Humanität und Menschenrechte sei sie – dies aber strikt – verpflichtet. (S. 195)
„Humanisierung“ stellt folglich das zweite Prinzip dar.
„Menschlichkeit ist seine [des christlichen Glaubens] einzige im strengen Sinn kategorische, das heißt bedingungslose Voraussetzung.“ (S. 197)
Zur Prinzipien-Trias einer in ihrer Tiefe erneuerten Theologie gehört dann auch eine „Entdogmatisierung“ (S. 198). Schließlich sei das Christentum keine „dogmatische Religion“ (J. Splett), sondern eine praktische: eine Angelegenheit der Nachfolge, die ihrerseits über Zugehörigkeit entscheide. Sein Glaube sei zudem nicht in ein „verbindliches geschlossenes System [zu] zwängen“. (S. 199)
In direktem Anschluss daran stellt Benk auf nur 30 Seiten – provisorisch und ohne jeden Systemanspruch – Thesen einer Revision vor. Leitendes Kriterium haben demnach Botschaft und Wirken Jesu zu sein, wobei die neutestamentlichen Hoheitstitel gerade nicht als „implizite Christologie“ zu verstehen seien. Diese diene ja nur dazu, eine Konstruktion linearer Entwicklung vom historischen Jesus zur klassischen Christologie von Nicäa bis Chalkedon zu konstruieren, was die Exklusion des Jüdischen, ja, eine antijüdische Identitätsformulierung nur verfestige. Denn die „implizite Christologie“ hebe vom Ansatz her darauf ab, die „Besonderheiten und Unterschiede bei Jesus im Vergleich zu seinem jüdischen Umfeld“ auszumachen und sei deshalb „per se antijüdisch“ (S. 208). Sie habe sich als eine Facette der „systematischen Enteignungsstrategie gegenüber dem Judentum“ erwiesen. (S. 209) Sofern solche Exklusion des Jüdischen dahinführe, dass Nicäa, pars pro toto für die klassische Christologie, zur christlichen Identitätsaussage schon genüge, könne man sich selbst von Nicäa „verabschieden“. (S. 120) In einer revidierten Theologie seien die Hoheitstitel dagegen als Bestärkung der Reich-Gottes-Botschaft zu verstehen. Denn die klassische Christologie stelle zwar eine „beeindruckende inkulturative Aneignung und Transformation des Glaubens […] in einem veränderten geistesgeschichtlichen Horizont“ dar (211), könne heute aber nicht mehr als klärende Explikation der Jesus- Gestalt und -Botschaft dienen; sie bleibe vielmehr ihrerseits „‘von vorne‘“, aus der „Perspektive der in ihrem jüdischen Kontext verstandenen Jesusbewegung“ zu begreifen. (S. 212) Zugunsten einer Betonung der Reich-Gottes-Botschaft bleibe zudem eine Sühneopfertheologie zu verabschieden, auch wenn schon bei Paulus „die Errettung der Menschen aus ihrer Sündenverfallenheit“ im Zentrum gestanden habe. Denn im Grund gehe es um die Alternative, ob
„Gott als eine Macht vorgestellt wird, die Gerechtigkeit schafft und befreit – oder als ein Gott, der ein Menschenopfer benötigt oder auch nur zulässt, damit sich die Menschheit mit ihm wieder ‚versöhnen‘ kann.“ (S. 217)
Auf dieser Linie liegen auch die Postulate „Diesseitsorientierung statt Jenseitsvertröstung“ (S. 218) und „Politisch engagiert statt seelenheilfixiert“ (S. 223). Benk beschließt den Band mit einer knappen Zusammenfassung und einem Bekenntnis von D. Sölle, das er sich zu eigen macht.
Dieses gut lesbare Buch, das für breitere als nur akademisch- theologische Kreise geschrieben scheint, kann und will wohl auch provozieren. Seine Engagiertheit verlangt auch vom Rezensenten, wenn kein Bekenntnis, so doch eine Standortnennung: Ich teile Benks Grundthese, dass das Ganze des christlichen Glaubens und seiner Theologie bis in ihre Tiefe hinein der Umkehr bedarf, wenn es überhaupt noch gelingen soll, authentisch Christ*in und Kirche sein zu können. Auch die Option für eine christliche Identität, die entscheidend praktisch verfasst ist, bzw. für einen Primat von Orthopraxie vor Orthodoxie teile ich. Dogmen als solche zumindest tendenziell zu überwinden, scheint mir dagegen mit Seewald, Metz, Marquardt u.a. weder möglich noch sinnvoll und notwendig.
Zumal in systematisch-theologischer Perspektive drängen sich Fragen auf, was auch damit zu tun haben dürfte, dass Benk zwar einschlägige exegetische Literatur rezipiert, doch irritierenderweise fast keine systematische. Dabei erschienen zumal seit den 1990er Jahren einige Studien, die mit Benks eigenem radikalen Fragen durchaus verwandt sind.[1]
Inklusivität/Exklusivität
Zu fragen ist beispielsweise, ob die Kategorien Inklusivität/ Exklusivität hinreichend eine so ambitionierte Selbstvergewisserung und -projektion von Theologie tragen? Abgesehen davon, dass mir die Belege für die kirchliche Exklusion in diesem Kontext etwas unproportioniert breit entfaltet erscheinen, fragt sich, ob ihre Rückführung auf die Ablehnung des Jüdischen in der eigenen Identitätsformulierung sie wirklich erklärt und hinreichend verständlich macht.
Doch hier gewichtiger: Wie soll auch bei der notwendigen „Reintegration“ des Jüdischen im Christlichen das nachbiblische, also auch gegenwärtige Judentum christlich gedacht werden? Auf die Versuche einer neuen Verhältnisbestimmung geht Benk deshalb nicht ein, weil es nicht genüge, diese Relation oder
„das Wesen des Judentums neu bestimmen zu wollen, wie der emeritierte Papst wähnte. In Frage steht vielmehr das Wesen des Christentums selbst.“ (S. 120)
Wenn eine Neubestimmung der Relation wirklich das „Wesen“ des Christentums, der Kirche unberührt ließe, wäre dies in der Tat kritikwürdig, stellte es doch eine Verkennung und Verharmlosung dessen dar, was „zur Verhandlung“ steht: „Gottes Volk im ungekündigten Bund“ und damit nicht weniger als eine (potentielle) Zeugin und Bürgin von Gottes Wort und Handeln. Ein solches Zeugnis aber betrifft Kirche und Theologie in ihrer Verfasstheit. So verstanden aber kann m.E. auf Relationsaussagen zum nachbiblischen empirischen Judentum gar nicht verzichtet werden.
Schon die Diagnose einer Exklusion des Jüdischen suggeriert, dass sich christliche Identität „außerhalb“ von Jüdischem artikulierte. Das aber ist nicht der Fall: Es wurde und wird „auf Schritt und Tritt“ Alttestamentliches und Jüdisches im Christlichen präsent, allerdings – und das ist die enorme Herausforderung – im Modus der Enteignung, Degradierung via Allegorisierung und Bestreitung. Derart als fragwürdig und – mittlerweile klarer oder unklarer – auch als schuldhaft erkannte Umgangsweisen durchziehen das gesamte Gewebe des corpus christianum, Organ für Organ. Das aufzuarbeiten versetzt allerdings direkt in eine Beziehung zum Judentum, sonst bliebe eine derartige Revision und Neukonzipierung fragwürdig abstrakt. Die von Benk zurecht postulierte radikale Neukonzeption des Christlichen kann von daher nicht ohne eine explizite Theologie des Judentums geschehen. Ohne eine solche besteht die Gefahr, dass das Judentum nivelliert und subsummiert wird unter einen Plural von Religionen und Weltanschauungen. Dies geschieht, soweit ich sehe, oft genug in Erwachsenenbildung und Religionspädagogik, wenn nicht auch Theologie. Ein solcher nivellierend-pluraler Blick mag der Religionswissenschaft möglich sein; einer Theologie aber ist er m.E. verwehrt, will sie nicht radikale Herausforderungen überspielen. Nur wenn Jesus nicht in eine Reihe von „Religionsstiftern“, die Gemeinschaft seiner Nachfolger*innen nicht in eine von Religionen subsumiert wird, bleibt die Anfrage an die una sancta ecclesia durch das Gegenüber eines Judentums als Volk Gottes im ungekündigten Bund profiliert und scharf. Und ebenso die, wie sich neben diesem und ihm gegenüber von Christi Heilsmittlerschaft sprechen lässt. Das erst zeigt die radikale Infragestellung von Kirche und Theologie.
Der weiße Fleck einer expliziten Beziehung zum nachbiblischen, also auch gegenwärtigen Judentum zeigt sich auch im abschließenden Credo. Bezeichnenderweise enthält das sehr frei formulierte Bekenntnis keinen Verweis auf Israel etwa im Sinn von: „Ich glaube an den Gott Israels …. an Jesus Christus, den Sohn Israels“ oder darauf, dass wir „an der Seite Israels“ die „Auferstehung von den Toten“ erwarten.
Als These für die weithin noch ausstehenden Revisionen sei formuliert: So wenig das, was als Theologie des Judentums bezeichnet wird, ohne Zeitindex „nach Auschwitz“ möglich ist, so wenig ist es eine Revision von Theologie nach der Schoah ohne klare und verbindliche Erklärung darüber, was christlichem Glauben das gegenwärtige Judentum bedeutet. Da im Gegenüber des Judentums Inklusion zu denken aber schlicht absurd wäre, verlangen die Kategorien von Inklusion/ Exklusion mindestens eine Erweiterung. Ein nachidealistisches Verständnis von Partikularismus und Universalität, wie Lévinas es etwa in seiner Rede von „universalistische(m) Partikularismus“ und „konkrete(m) Universalismus“ andeutet, scheint mir einen Weg zu weisen.
Absolutes und messianisches Wahrheitsverständnis
Der kirchliche Exklusivitätsanspruch artikuliert sich als ein absoluter Wahrheitsanspruch. Dessen strikte Zurückweisung zugunsten einer Orientierung an der inklusiven Jesusbewegung erscheint mir allerdings recht unvermittelt. Schließlich gehören auch schon zu dieser Bewegung das Staunen und anfängliche Erkennen einer eschatologisch messianischen Dimension dessen, dem nachgefolgt wird. Oder sollte der, auch von Benk als unerreichbar angesehene historische Jesus (S. 214) dann doch den Kanon im Kanon darstellen? Ist damit aber nicht die Kanonizität der ganzen Schrift, hier speziell die des gesamten Neuen Testaments, in Frage gestellt? Faktisch ist die Frage aufgeworfen, doch wird sie leider nicht behandelt.
Da das Ringen um Jesu Bedeutung nicht ablösbar von seiner Nachfolge ist, schießt m.E. die Kritik jeder „impliziten Christologie“ als per se antijüdisch übers Ziel hinaus. Eine so generelle Aussage ist auch argumentativ nicht notwendig. Benk selber macht ja den interessanten Vorschlag, die „implizite Christologie“ – also gibt es sie doch im Neuen Testament (!) – von der unbestritten zentralen Reich-Gottes-Botschaft aus zu begreifen und auf dieser Linie die klassische, also explizite Christologie nun – erstmals (!) – auch israelbewusst biblisch, also auch unter einem Primat der Orthopraxie zu rekapitulieren.
Den exklusiven, gewaltträchtigen Anspruch auf absolute Wahrheit zu überwinden, verlangte meines Erachtens, sie nicht via „historischer Jesus“ zu dekonstruieren. Es kann durchaus vom frühchristlichen Messiasbekenntnis aus geschehen, hinter das nicht zu gelangen ist: Auch so gelangte man vom Abstraktum absoluter Wahrheit, wie Benk es anzielt, in das geschichtlich-gesellschaftliche Ringen um Misere und Rettung, Unheil und Heil der Welt, zur Trauer um die ausstehende Parusie und die Hoffnung darauf. Ohne solchen auf Heil hin ausgerichteten, sich am Unheil abarbeitenden messianischen Wahrheitsanspruch könnte die Kritik absoluter Wahrheit zudem schnell auf eine nur schwache Toleranz allgemeiner Liberalität hinauslaufen. Ein solches messianisches Wahrheitsverständnis gehörte sicher einer Christologie in schwachen Kategorien an (J.B.Metz), wiese aber anstatt des Postulats „Humanität“ eindeutig theologische Kontur auf, die auch im Streit um Liberalitäten und Neo-Liberalitäten der Gegenwart hilfreich sein sollte.
Diese Anfragen und Anmerkungen wollen keinesfalls von der Lektüre abhalten – ganz im Gegenteil. Denn die Schwäche des Buches (diese oder jene Differenzierung nicht aufgenommen zu haben und manches Mal holzschnittartig unvermittelt zu verfahren) ist zugleich seine Stärke: jenseits verästelter Diskurse nochmals überaus klar und mutig die schmerzliche Wahrheit ins Bewusstsein zu bringen, an welchem Abgrund „Umkehr“ zu realisieren haben.
Ich wünsche dem Buch viele Leser*innen, deren engagierte Offenheit sich mit der des Autors messen kann, denen die Flanken, die es bietet, nicht Anlass werden, sich seinem Stachel für das Fleisch christlichen Glaubens und seiner Theologie zu entziehen.
Andreas Benk:
Christentum, Antisemitismus und Schoah.
Warum der christliche Glaube sich ändern muss.
Ostfildern: Matthias Grünewald Verlag 2022, 268 S., 28,- €