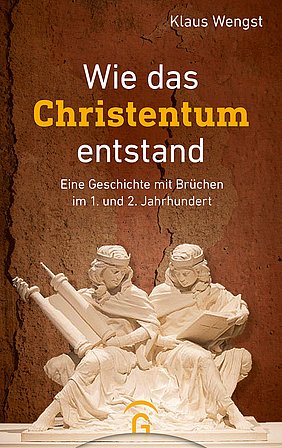Das Buch gliedert sich nach drei historischen Epochen des Christentums:
I. Der Anfang ist jüdisch: Von Jesus bis zum ersten jüdisch-römischen Krieg, S. 21–160,
II. Bruchstellen: Vom jüdisch-römischen Krieg bis ca. 100 d. Z., S. 161–274,
III. Im und nach dem Bruch: Von der Zeit um 100 bis zur Zeit um 150 d. Z., S. 275–345.
Zu I.: Die banale Feststellung zum ersten Abschnitt lautet also: Die ersten Christ_ innen waren Juden und Jüdinnen, nannten sich aber nicht so. Die Fremdbezeichnung Chrestiani/Christianoi wurde erst im 2. Jahrhundert zur Selbstbezeichnung, dann aber gleich antijüdisch gebraucht. (S. 19) Der Jesus in den Evangelien bleibe jüdisch bis hin zu seinem Tod und seine Anhänger_ innenschaft galt in den Augen seiner Zeitgenoss_innen ebenfalls als jüdisch. Wenn die Autoren der Evangelien von Jesus sprechen, tun sie das aus jüdischer Perspektive, aus der jüdischen Tradition heraus (S. 23) und rücken Jesus durchaus in die Nähe des Pharisäismus. Belegbar ist: Jesus stammt aus Nazareth, die Eltern waren fromme Juden (S. 24). Jesus ist von Johannes getauft worden; diese Taufe war ein innerjüdisches Zeichen. (S. 24) Jesus hat Lernende um sich gesammelt, und Jesus selbst wird als Lehrer charakterisiert (S. 25). Jesus ist im jüdischen Land lehrend umhergezogen (S. 25). Jesus hat das Reich Gottes, d.i. die Herrschaft Gottes, verkündet, das sich in Recht und Gerechtigkeit abbildet (S. 26). Jesus ist am Kreuz von Römern hingerichtet worden (S. 27). Der Jesus in den Evangelien ist ein Jude unter Juden (S. 28ff). Erzählungen über ihn seien durchaus analog zu den Chassidim-Geschichten seiner Zeit, und auch theologisch habe Jesus zum Beispiel mit Chanina ben Dossa oder Rabbi Jochanan ben Sakkaj (S. 29) viel gemeinsam gehabt. Auf das zu vollziehende Tun des Willens Gottes komme es an: »Weisheit bewährt und bewahrheitet sich in guten Taten. Tut sie das nicht, ist sie nichts wert und erweist sich faktisch als nicht existent. Entscheidend ist nicht, dass man etwas sagt; entscheidend ist, dass man tut, was man sagt.« (S. 33) Das Tun selbst benötige aber eine Anleitung, eine Richtung (S. 34), denn Recht, Verlässlichkeit und Frieden seien die Säulen der Erde (S. 35). In Klaus Wengsts Darstellung des Pharisäismus sind die Verbindungslinien zu Jesus zu sehen, und Jesus ist nicht isoliert von seinem Volk zu interpretieren (S. 38). Von seinen Anhänger_ innen werde Jesus als Gesalbter, d.i. Messias, gesehen; im Griechischen heißt er Christos – Jesus ist der Gesalbte, ist der Sohn Gottes (S. 41). Gott habe am gestorbenen Jesus gehandelt, als er selbst nichts mehr tun konnte – die Auferweckung Jesu werde als endzeitlichneuschöpferische Tat beschrieben und geglaubt (S. 43): »Es ist der in Israel bezeugte und dort schon längst bekannte Gott, der in und durch Jesus zu Wort und Wirkung kommt.« (S. 44) Der Anfang liege also in dem Bekenntnis: »Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. « (S. 45) Die sich dann entwickelnde Schüler_ innen- und Zeug_innenschaft seien allesamt jüdisch und auch das Selbstverständnis dieser Menschen sei jüdisch gewesen, und das, was mit Jesus bedeutet wurde, sei nur innerhalb der jüdischen Tradition verstehbar (S. 49). Pfingsten könne also nicht der Geburtstag der Kirche sein, sondern die Menschen orientierten sich am jüdischen Wochenfest, und im sog. Pfingstwunder habe sich ein jüdisches Selbstverständnis (S. 51) etabliert. Die Taufe durch Johannes den Täufer »nimmt prophetische Traditionen auf, wenn er den kommenden Gott als ganz nah andrängenden verkündet«. (S. 58) Stephanus sei dann auch nicht der erste christliche Märtyrer gewesen, sondern ein Opfer rivalisierender, hebräisch sprechender und griechisch sprechender Jüdinnen und Juden. (S. 61) Stephanus war Mitglied der messiasgläubigen Minderheit und ist in einem tumultartigen Gewaltakt zu Tode gekommen. (S. 76) Die weitere Entwicklung geschah dann durch das Hinzukommen von Menschen aus den Völkern zur messiasgläubigen Gemeinde. (S. 77) Im Umkreis der Synagogengemeinden gab es auch immer nichtjüdische Sympathisantenschaft, die zum Teil jüdische Lebensweise annahmen und zum Beispiel auch den Schabbat mitfeierten (S. 81). Diese Gruppe der Gottesfürchtigen sei dann auch die Zielgruppe der messianischen Verkündigung (S. 83) gewesen; die jüdischen Gemeindeglieder in der messiasgläubigen Gemeinde behielten dagegen ihre jüdische Identität. Die messiasgläubige Gruppe innerhalb der Synagogengemeinde hatte also eher aus dem Kreis der Gottesfürchtigen auch nichtjüdische Mitglieder (S. 87), was jedoch für die traditionelle Synagogengemeinde einen Affront darstellte und zu Konflikten führen musste (S. 89). Paulus bzw. Saulus war in seiner Selbstwahrnehmung zuerst einer der Wortführer gegen den messiasgläubigen Teil der Gemeinde und dann nach seinem Damaskuserlebnis ihr Unterstützer. Die Streitpunkte in diesem Konfliktfall seien die richtige Torahpraxis und die Torahauslegung und die jüdische Identität gewesen, die sich in Beschneidung, Speisegesetzen und in der Regelung des Schabbats zeigte. Paulus habe stets seine jüdische Identität betont, an der er auch festhielt (Phil 3,4b-6; 2 Kor 11,22). Er sei sowohl in der hebräischen als auch griechischen Sprache zu Hause gewesen, und stets habe er sich auf die Lebensführung im Judentum (S. 102) bezogen. Sein »Eifer« beziehe sich aber zuerst »gegen diejenigen Landsleute, die diese Grenzmarkierungen gegenüber der nichtjüdischen Welt überschreiten oder gar beseitigen«. (S. 103) Paulus sehe bei denjenigen, die um der »Heiden« willen auf eine jüdische Lebensweise verzichten, einen Abfall von Gott (S. 107). Sein sog. Damaskuserlebnis deutete Paulus jedoch mit Hilfe der überlieferten Sprachmuster prophetischer Berufungen (S. 111). Thema seiner Berufung sei das Verhältnis Israels zu den Völkern und zum Gott Israels (S. 112). Mit Bezug auf Jes 53 begründe Paulus »das erhöhende Handeln Gottes an Jesus mit der Selbsthingabe in den Tod.« (S. 121) Jesus als der Messias sei deswegen auch nicht Subjekt dieses Weges, sondern Objekt des Handelns Gottes. (S. 121) Jesus bekomme als Messias den Namen Gottes, werde dabei aber nicht zum Gott gemacht, könne nicht mit Gott verwechselt werden und sei Gott nicht gleichgesetzt: »Gottes erhöhendes Handeln an bis zum Kreuzestod erniedrigten Jesus, das sich in der Verleihung seines erhabenen Namens ausdrückt, intendiert weiteste Anerkennung und erweist sich so als Mittel, dass Gott selbst die Ehre gegeben wird.« (S. 123)
In Antiochia gab es eine messiasgläubige Gemeinde aus jüdischen und nichtjüdischen Gemeindegliedern (S. 124) – Nichtbeschnittene und Beschnittene lebten zusammen, und Menschen aus den Völkern mussten nicht erst jüdisch werden. Das genau sei jedoch der Kritikpunkt der jüdischen Messiasgläubigen aus Israel/ Palästina (S. 124) gewesen – hier würde das traditionelle jüdische Konzept der Beschneidung fokussiert: Paulus und Barnabas hätten dieses Ansinnen zurückgewiesen (vgl. Apg 15,2; Gal 2,1-3; Röm 3,1-2). Paulus habe darauf beharrt, dass messiasgläubige nichtjüdische Männer nicht beschnitten werden müssten (S. 127): beschneidungsfreies Evangelium des Paulus für die Völker (S. 128), das in Jerusalem anerkannt worden sei. Diese Beschneidungsfreiheit habe aber nur für die hinzukommenden Nichtjuden gegolten (S. 129); die Gültigkeit der Torah stehe jedoch außer Frage. Paulus habe aber so argumentiert, dass die Gebote der Torah, die sich auf die spezifisch jüdische Lebensweise bezogen, für die messiasgläubigen Nichtjuden aus den Völkern nicht gültig seien. (S. 129) Für Paulus sei die Gabe von Gottes Geisteskraft entscheidend (S. 131): »Auf dem Aposteltreffen wurde grundsätzlich entschieden, dass hinzukommende Menschen aus den Völkern nicht ins Volk Israel integriert werden müssen.« (S. 135)
Problematisch blieb jedoch trotzdem das Zusammenleben in den messianischen Gemeinden zwischen Juden und Nichtjuden (S. 135) – wie findet also gemeinsames Leben unter jüdischen bzw. nichtjüdischen Bedingungen statt? Das Aposteldekret gehe nicht hinter das Jersualemer Treffen zurück und bleibe von Lev 17-18 inspiriert (S. 139). Vor allem in Bezug auf das sog. Götzenopferfleisch habe man sich auf Lev 17,1-9 bezogen; ebenso sei der Blutgenuss ausgeschlossen gewesen (Gen 9,4; Lev 17,10-14). Immer gehe es zuerst um eine konkrete Praxis und um die Ermöglichung des Zusammenlebens unter jüdischen Bedingungen (S. 141), weil hier das Augenmerk auf den jüdischen und nicht auf den nichtjüdischen Menschen gelegen habe (S. 141). Die Lösung des Aposteldekrets sei für Paulus nicht hinnehmbar (S. 142) gewesen. Die Option, die sich längerfristig durchgesetzt habe, sei jedoch die paulinische Position gewesen (S. 147). Von der messiasgläubigen Gruppe in Jersualem seien hier Jakobus, Kephas und Johannes wichtig (Gal 2,6-9; vgl. auch Mt 20,20-23; Mk 10,35-40; Apg 12,1-2) – aber deren Geschichte bis zum jüdisch-römischen Krieg bleibe mehr oder weniger ein weißer Fleck in der Historie (S. 148) und bis zum jüdisch-römischen Krieg habe es auch noch kein Christentum gegeben (S. 156)! Was bis dahin über Jesus als den Messias ausgesagt worden sei, sei innerhalb jüdischer Tradition geblieben: »Es macht Jesus nicht zum Gott, tastet die Einzigkeit Gottes nicht an.« (S. 159)
Ad II.: Der jüdisch-römische Krieg (66–70 n. Chr.) stelle einen tiefen Einschnitt sowohl in der Geschichte Israels als auch in der Geschichte der jungen Christengemeinde dar. (S. 161) Anlass für den Krieg sei der Konflikt zwischen Tempel- und Kaiserkult gewesen oder auch das Ausbeutungsverhalten des römischen Präfekten Gessius Florus richtete zweimal ein Blutbad unter der jüdischen Bevölkerung an. (S. 165) Der von Nero beauftragte Vespasian sollte den Krieg in Judäa führen, was er ab 67 n. Chr. auch tat. Sein Sohn Titus nahm dann als letzten Akt des Krieges die Stadt Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. ein: Der Tempel wurde zerstört und Tempelschatz und Tempelgeräte geplündert (S. 168).
Die Folgen des Krieges waren verheerend, verbunden mit Massakern und Massenhinrichtungen (S. 169). Der jüdischen Bevölkerung wurde eine sog. Judensteuer überall im römischen Imperium auferlegt (fiscus judaicus) (S. 170). Überlebende Aufständische mussten in den Untergrund oder flohen; die priesterliche Aristokratie der Sadduzäer war an den Tempel gebunden (S. 172) und somit zu Ende; die essenische Siedlung in Qumran wurde zerstört (S. 173). Die Pharisäer bemühten sich, die Torah ins Alltagsleben zu übersetzen (S. 175), und die auf Jesus als Messias bezogene Gruppe musste sich in den Nachkriegswirren neu aufstellen (S. 179). In Javne wurde unter Jochanan ben Sakkaj das jüdische Lehrhaus gegründet, was die Entstehung des rabbinischen Judentums nach sich gezogen habe (S.180): »Die Bindung an die Tora ist entscheidend. Aber die Tora muss ausgelegt werden.« (S. 182) In diesem neuen theologischen Modell sei G*tt nicht mehr an den Tempel gebunden; die Sühnerituale des Tempels würden durch freundliche Haltung ersetzt und das Nachdenken über Opferrituale gelte so, als hätte man sie realiter vollzogen (S. 184). Die Diskussionen und Kontroversen wurden überliefert und weiterdiskutiert (S. 185). Mehrheitsentscheidungen waren konsensfähig (bBava Mezia 59b). Die messiasgläubigen Juden seien auf einmal nicht mehr im Synagogenverbund integrationsfähig gewesen und würden später dann zu Häretikern erklärt (S. 187). Die junge Christengemeinde habe nun nach einer neuen Identität gesucht, und so seien dann auch die vier kanonischen Evangelien entstanden, die als Texte der Vergewisserung dienten. Die Auseinandersetzungen zwischen dem frühen rabbinischen Judentum und der messiasgläubigen Gruppe seien jedoch immer noch innerjüdische Auseinandersetzungen (S. 192)! Das Matthäusevangelium sei in einem jüdischen Kontext verortet (S. 192); das Griechisch des Mt-Evangeliums zeige einen hebräischsprachigen Hintergrund – Jesus sei der messianische König, der Sohn Davids und deswegen Gesalbter (S. 193). Gleichzeitig in Übereinstimmung mit der pharisäisch-rabbinischenTradition werde Jesus als der Torah charakterisiert (S. 194). Der Unterschied zwischen Reden und Tun sei wichtig. Sachlich stimme der Mt-Jesus mit der pharisäischen Lehre überein (S. 199), aber sein messianischer Anspruch werde zurückgewiesen; auch dass Jesus von den Toten auferweckt sei, stehe in Frage (S. 200). Im Joh-Evgl. stünden die Juden pauschal feindlich Jesus gegenüber (S. 201), was ein Reflex auf die soziale Wirklichkeit der Abfassungszeit des Joh darstelle; die jüdische Welt sei pharisäisch bestimmt (S. 202) und stelle die Mehrheitsströmung im Volk dar. Mit Jesus wollte man nicht in Verbindung gebracht werden (S. 204). Aber Johannes wollte wie Mt zeigen, dass Jesus der messianische König sei (S. 207). Heiligung von Gott sei bei Joh als Beauftragung verstanden und »[i]n dem, was Jesus sagt und tut, zeigt sich Gott selbst.« (S. 211) Die zeitgeschichtliche Situation des Joh zeige die innerjüdische Auseinandersetzung um das Phänomen Häresie (S. 213). Die Mehrheit habe den Anspruch der Jesus- Leute nicht nachvollziehen können und habe in ihnen Häretiker gesehen. Auch den Messiasgläubigen, die aus dem Judentum stammten, galt die Judensteuer – Männer hätten sich aufgrund der Beschneidung dem fiscus judaicus nicht entziehen können (S. 215) –; die Distanz zur Synagoge sei aber dadurch größer geworden, denn die Christ_innen hätten versucht, sich dieser Steuer zu entziehen; umgekehrt hätten jüdische Autoritäten gegen die christlichen Gemeinden gehetzt (S. 217). Der Verfasser des Lk-Evangeliums und der Apg benutzte die LXX und formulierte sein Evangelium aus der Perspektive der sog. Gottesfürchtigen. Die Pharisäer würden nicht so stark in Stellung gebracht, das Gemeinsame werde betont (S. 221). Das Evangelium fordere jedoch die römische Macht heraus. Die Jesus- Leute würden als öffentliche Unruhestifter gesehen und politischer Illoyalität bezichtigt (S. 225). Die jüdischen Identitätsmerkmale seien jedoch auch bei Lukas wichtig, und sie gelten als Zeichen des Widerstands gegen Rom (S. 229). Dieser Zug zeige sich auch in der Offenbarung des Johannes; in ihr würde die Verweigerung gegenüber dem römischen Gewaltsystem offensichtlich (S. 230). Die an Jesus als Messias glaubenden Menschen wurden von der römischen Umgebung zuerst als Chrestianer bezeichnet (= gr. Christianoi ); zuerst war diese Bezeichnung eine Fremdbezeichnung, später im 2. Jahrhundert wurde daraus eine Selbstbezeichnung (S. 245), gemeint sind Messiasgläubige aus den Völkern (S. 246; 1 Petr 1,17). Schon im Epheser-, stärker im Kolosserbrief würden die Trennlinien zwischen »Juden« und »Christen« deutlicher (S. 255). Die Gemeinschaft zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen bleibe als »Leib erhalten mit Christus als »Haupt« (S. 257); die Christus-Interpretation werde, so Wengst, jedoch hellenisiert und mit der Logos-Philosophie neu kontextualisiert (S. 269).
Ad III. : Der erste Clemensbrief markiere nun deutlich die Distanz zwischen jüdischen und christlich-römischen Menschen (S. 276). Clemens selbst war Römer und kein Jude mehr und der »Gehorsam gegenüber Gott und der Gehorsam gegenüber den Herrschenden entsprachen einander.« (S. 278) Clemens denke konsequent römisch und auch patriarchalisch – Christus werde nicht mehr mit dem Messianischen verbunden sein (S. 279). Das gegenwärtige Judentum komme nicht mehr in den Blick (S. 280). Gemäß einem militärischen Vorbild würde die Struktur der christlichen Gemeinde hierarchisiert (S. 283), und Israel werde im ersten Clemensbrief enterbt (S. 290). Der ebenfalls nicht kanonische Barnabas-Brief stamme wahrscheinlich aus der Zeit um 130 n. Chr. (S. 291): Jüdisches, so Wengst, sei ihm fremd, und deswegen komme es auch zu Fehlinterpretationen und zu einer negativen Sicht des Judentums (S. 293).
Der Bruch des Christentums mit dem Judentum scheint hier vollzogen zu sein (S. 297). Identität geschehe hier durch Abgrenzung vom Judentum (S. 301). Die Israelvergessenheit setze sich dann in den Pastoralbriefen des Neuen Testaments fort (S. 303), und das junge Christentum übernehme aus dem philosophischen Kontext auch den Leib-Seele-Dualismus der platonischen Philosophie, der Bezug zur messianischen Tradition des Judentums fehle in den folgenden Schriften gänzlich.
Das Buch von Klaus Wengst liest sich sehr spannend; gern hätte der Lesende jedoch noch mehr über das sogenannte Apostelkonzil, die Haltung der Jerusalemer Säulen, gewünscht und mehr über den Konflikt mit Paulus erfahren. Grundsätzlich eignet sich das Buch jedoch hervorragend für den Einsatz in Universität und Schule und gibt dem Lesenden einen profunden Einblick in die Anfangsgeschichte des Christentums.
Wengst, Klaus:
Wie das Christentum entstand. Eine Geschichte mit Brüchen im 1. und 2. Jahrhundert
Gütersloh 2021: Gütersloher Verlagshaus, 351 Seiten